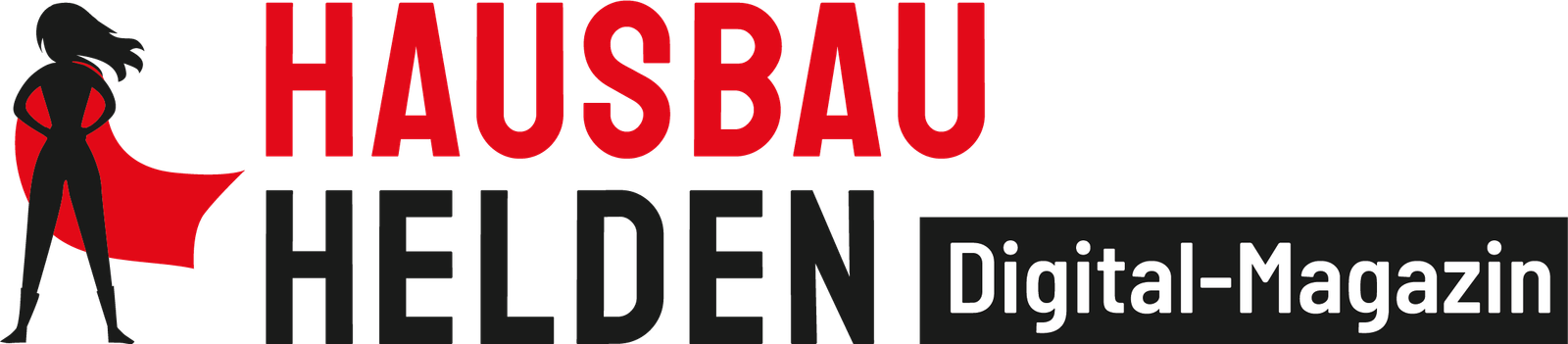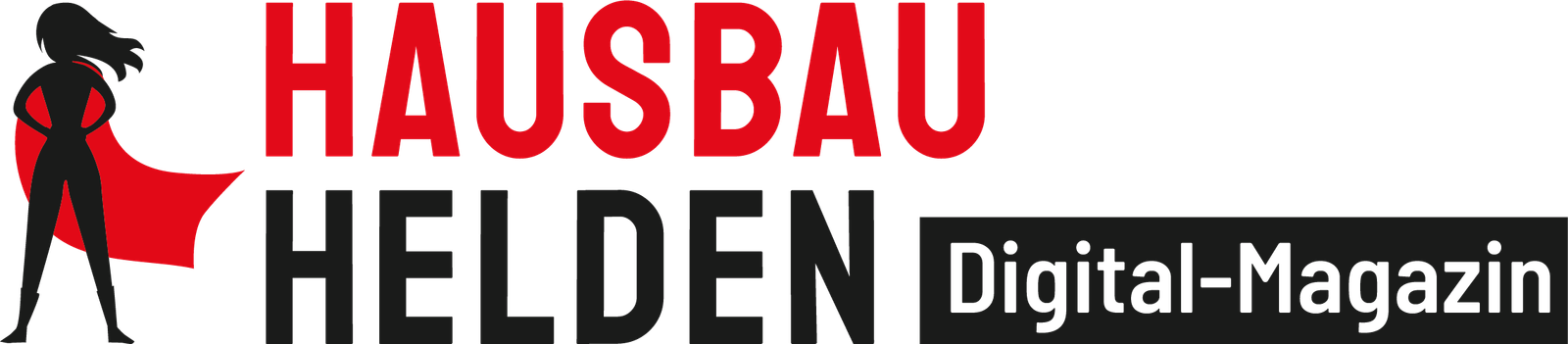Alles gut bedacht?!
Das Dach hat nicht nur viele bauliche Funktionen zu erfüllen, es bestimmt auch die Aufenthaltsqualität der darunterliegenden Räume. Worauf es bei der Planung ankommt, damit das Wohnen ganz oben richtig Spaß macht.
Texte: Dipl.-Ing. Hans Graffé
Der Frage, wie dein zukünftiges Dach über dem Kopf aussehen soll, kannst du dich aus verschiedenen Richtungen nähern. Drei zentrale Fragen helfen bei der Planung:
- Welche Optik wünschst du dir und was ist überhaupt erlaubt?
- Welche Nutzung ist vorgesehen?
- Welche technischen Anforderungen sind zu berücksichtigen?


Fotos: links luisviegas, rechts bialasiewicz/www.elements.envato.com
Je nachdem welche Architektur dein neues Zuhause haben soll und was auf deinem Baugrundstück baurechtlich zulässig ist, bestimmt maßgeblich die Wahl des Daches und seiner Gestaltung. Denn Dachform, Neigung, Trauf-höhe, Firstrichtung und Eindeckung bestimmen ganz wesentlich den Charakter eines Gebäudes. Dabei ist ein Blick in den Bebauungsplan unerlässlich, denn vielerorts sind genau diese Parameter klar geregelt. Auch wenn ein cooles Pultdach noch so schön wäre: Steht im Bebauungsplan „Satteldach“, musst du diesbezügliche Über-legungen nicht weiterverfolgen.
Auch die Art der Nutzung des Dachraumes ist entscheidend. Als Wohnraum muss das Dach selbstverständlich gedämmt werden, es benötigt ausreichend Licht und sollte sich im Sommer nicht überhitzen. Geht es darum, möglichst viel Wohnfläche auch bei kleinen Grundrissen zu erhalten, bietet sich ein Kniestock an. So bezeichnet man das Verlängern der traufseitigen Wände über die oberste Geschossdecke hinaus.

Moderne Haustechnik befindet sich bei modernen Häusern nicht mehr nur im Keller sondern auch auf dem Dach. Wird beispielsweise Photovoltaik geplant, sind Ausrichtung und Dachneigung relevant, aber schlicht und ergreifend auch der zur Verfügung stehende Platz. Ist der durch Gauben oder Dachfenster knapp, schränkt das die Möglichkeiten stark ein.
Dachform und -konstruktion
Die Form des Daches prägt den optischen Charakter des Hauses maßgeblich, beeinflusst das Platzangebot und die Nutzungsmöglichkeiten. Das sind die wichtigsten Dachformen:
 |  |  |  |  |
| Pultdach | Satteldach | Walmdach | Zeltdach | Flachdach |
| die moderne Dachform, sieht cool aus und ist noch dazu günstig herzustellen. Bietet dank großer Dachfläche gute Voraussetzungen für PV-Nutzung | der bewährte Klassiker, einfach und preisgünstig, flexibel anpassbar, je nach Dachneigung jedoch im Verhältnis zur Grundfläche wenig nutzbarer Raum (niedrige Kopfhöhe) | die edle Variante, optisch attraktiv, jedoch eher hochpreisig, guter Witterungsschutz in alle vier Himmelsrichtungen, Nutzung für Solarenergie aufwendig | für den Stadtvilla-Look, nur für quadratische Grundrisse, aufwendig herzustellen, Nutzung für Solarenergie ebenfalls aufwendig | Alternative für Puristen, bestmögliche Raumnutzung, in der Vergangenheit häufig fehlerbehaftet, Solarnutzung nur mit Aufständerung möglich |
Jedes Dach besteht aus dem tragenden Gerüst (meist aus Holz), einer schützenden Außenhaut (Ziegel …) und der Wärmedämmung. Hinzu kommen Ein-, Auf- und Anbauten wie Schornstein, Dachfenster, Gauben, Rinnen und Fallrohre. Doch der Reihe nach.
Ohne geht nichts: die Dämmung
Damit es im Winter schön warm im Haus bleibt, muss das Dach selbstverständlich gedämmt werden. Dafür steht eine Reihe von Materialien zur Verfügung, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben.
Die wichtigste Eigenschaft eines Dämmstoffes ist sein Dämmwert, genauer gesagt seine Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger der Wert, desto besser. Hat ein Holzfaserdämmstoff z.B. einen Wert von 0,042 W/mK, entspricht er der Wärmeleitstufe WLS 042. So lassen sich unterschiedliche Dämmstoffe leicht vergleichen. Häufig findet man noch die Bezeichnung Wärmeleitgruppe: 035, 040, 045 usw. Hier wurden einfach die Zwischenwerte in Fünferschritten zusammengefasst, der o.g. Holzfaserwerkstoff entspräche also WLG 045.
Für den sommerlichen Wärmeschutz spielt neben der Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes auch das Gewicht eine Rolle (je schwerer, desto besser) und seine Wärmespeicherfähigkeit. Doch welche Dämmstoffe stehen im Dach überhaupt zur Verfügung? Grundsätzlich unterscheidet man:
- Mineralische Dämmstoffe
Glaswolle, Steinwolle: preiswert, nicht brennbar, kann Haut- und Atemwegreizungen verursachen, mittlerer Dämmwert - Synthetische Dämmstoffe
Polystyrol (EPS/XPS): preiswert, Erdölprodukt, brennbar
Polyurethan (PUR/PIR): bester Dämmwert, teurer als Polystyrol
Synthetische Dämmstoffe weisen die besten Dämmwerte auf - Natürliche Dämmstoffe
Holzfaser: nachhaltig, guter sommerlicher Wärmeschutz
Zellulose: umweltfreundlich, da aus Altpapier hergestellt
Schafwolle, Hanf u.a.: nachhaltig, aber hochpreisig
Der Dämmwert natürlicher Materialien ist etwas geringer als der von anderen Materialien
Ist dir Nachhaltigkeit wichtig, haben ganz klar natürliche Baustoffe wie Holzfaser und Cellulose die Nase vorn.
Geht es um Kosteneffizienz, sind Glaswolle und Polystyrol eine Überlegung. Beim Brandschutz haben Mineral-
und Glaswolle ihre Vorzüge. Die geringsten Aufbauhöhen erzielt man mit Polyurethan.
| Dämmstoffe | Eigenschaften | Wärmeleitgruppe |
| Steinwolle | Steinwolle setzt sich zusammen aus der Schmelze von Spat, Dolomit, Basalt, Diabas, Anorthosit sowie Recyclingmaterial | 035 – 045 |
| Glaswolle | Glaswolle besteht zu bis zu 70% aus Altglas, dazu kommt Sand, Kalkstein und Soda. Das Material weist ein gutes Brandschutzverhalten auf | 032 – 045 |
| Polystyrol (EPS) | Polystyrol gibt es hauptsächlich als Plattendämmung und ist synthetisch hergestellt. Das Material eignet sich für das Dämmen von Zwischenräumen und Decken | 030 – 040 |
| Polyurethan-Hartschaum (PUR) | PUR erreicht trotz geringer Plattenstärken einen hohen Wärmeschutz. Durch die Form als Platten eignen sich die Materialien für die Flachdachdämmung | 025 – 030 |
| Holzfaser | Holzfaserdämmung kann als Aufsparren- und Zwischensparrendämmung dienen. Sie besteht aus dem Abfall verschiedener Nadelhölzer | 040 – 050 |
| Zellulose | Zellulose gibt es als Dämmplatte oder Flocken für die Einblasdämmung, wird aus Altpapier hergestellt | 040 – 045 |
| Flachs/Hanf | Flachs und Hanf sind zur Steildachdämmung geeignet. Bei sehr hohen Dämmstärken benötigt das Material zusätzliche Stützfasern, um die Form zu behalten | 040 |
Die Eindeckung bestimmt den Look
Satteldächer sind bei uns am verbreitetsten, klassischerweise kommen sie mit Dachziegeln aus Ton daher. Schon die Römer setzten auf diese Lösung! Tonziegel sind sehr witterungsbeständig und haben eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Ungünstig im Sinne der Nachhaltigkeit sind die hohen Temperaturen, die zum Brennen erforderlich sind, vorteilhaft dagegen die Verwendung natürlicher Rohstoffe wie Lehm und Ton.

Die preisgünstige Alternative zu Ton sind Dachsteine aus Beton. Sie sind deutlich schwerer, was einen leichten Vorteil in Sachen Schalldämmung bedeutet. Betonziegel sind weniger energieintensiv in der Herstellung als Tonziegel, da nur der benötigte Zement bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Es wird jedoch zusätzlich immer knapper werdender Sand benötigt. Eine eindeutige Empfehlung abzugeben ist schwierig. Beide Varianten – Dachziegel und Dachstein – sind langlebig, in vielen Farben verfügbar und leicht zu verarbeiten.
Schiefer ist ein Naturprodukt. Das Material hat eine lange Tradition im Dachdeckerhandwerk und überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Die Farbpalette bewegt sich im Bereich Grau/Schwarz, je nach Baugebiet ist die Zulässigkeit zu prüfen. Die Verarbeitung ist erfahrenen Handwerkern vorbehalten, die Kosten im Vergleich zu Betonsteinen oder Dachziegeln entsprechend hoch.
Auch Metall als Dachdeckung ist eine eher hochpreisige Variante. Meist wird Aluminium oder Titanzink in Form von großformatigen Trapezblechen verwendet. Damit ist eine sehr moderne Gestaltung möglich, die zu klarer und puristischer Architektursprache passt.
Licht im Dach mit Gaube, Dachfenster & Co.
Richtig wohnlich wird es unter dem Dach erst, wenn es auch schön hell ist. Neben Glasflächen auf den Giebelseiten bieten sich Dachfenster hier als einfache Lösung an. Es gibt sie in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen, ganz nach den persönlichen Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner. Mitdenken muss man unbedingt an einen wirksamen Sonnenschutz, z.B. in Form von außen liegenden Markisen oder Rollläden. Der Wärmeeintrag über ungeschützte Glasflächen ist immens und macht die Räume im Dach im Sommer schnell zum Brutkasten.

Foto: BGStock72/www.elements.envato.com
Inwieweit Gauben zur Architektur und zum Wohnkonzept passen, sollte man frühzeitig mit dem Planer besprechen. Zu bedenken ist dabei, dass sie nicht nur erhebliche Mehrkosten verursachen, sondern die für Solartechnik verfügbare Dachfläche gegebenenfalls erheblich einschränken. Dabei geht es nicht nur um die eigentliche Gaube, sondern auch um die verursachte Verschattung, die die Effizienz der Solaranlage beeinträchtigt.
Das Dach als Energielieferant
Die bestmögliche Nutzung der Sonnenenergie im Auge zu behalten sollte heute bei jedem Neubauprojekt Standard sein – wenn sie nicht wie beispielsweise in Baden-Württemberg – sogar gesetzlich vorgeschrieben ist.
Strom ist die Energieform der Zukunft – vom eigenen Dach ist er klimafreundlich und kostengünstig und damit ein wichtiger Baustein in nahezu jedem Energiekonzept. Photovoltaik lohnt sich besonders, wenn mit einer Wärme-pumpe geheizt wird und ein Elektroauto genutzt wird. Der Staat unterstützt die Investition in PV-Anlagen auf verschiedene Art und Weise, unter anderem durch eine auf 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung und den Entfall der Mehrwertsteuer bei der Anschaffung.

Foto: anatoliy_gleb/www.elements.envato.com
Auch Solarthermie, also die Nutzung der Sonne zur Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung kann eine Option sein. Aufgrund der Vielzahl der Einflussfaktoren und Abhängigkeiten empfiehlt es sich auf jeden Fall vor der Entscheidung fachkundigen und unabhängigen Rat einzuholen. Eine schlecht geplante oder installierte Solaranlage amortisiert sich langsamer oder spart im schlimmsten Fall dauerhaft kein Geld ein.
Schon in der Planungsphase des Gebäudes kann man einige Dinge im Hinterkopf behalten, die vorteilhaft für die Energieerzeugung auf dem Dach sind. So ist die Ausrichtung des Daches wichtig (Süden = höchster Ertrag, Ost-West = ebenfalls geeignet), die Dachneigung (sehr gut: 35 ° bei Südausrichtung, je größer die Abweichung von Süden, desto vorteilhafter ist ein flacherer Neigungswinkel) und eine möglichst große und verschattungsfreie Dachfläche.
Fazit
Bei der Konzeption des Daches geht es darum, die Optik, die vorgesehene Nutzung und die technischen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Die wichtigsten Parameter dabei sind Dachform, -konstruktion und
-neigung, Eindeckung, Dämmung, Belichtung und Solarenergienutzung. Tipp: Auch das „Drumherum“ wie die Dachentwässerung (Rinnen und Fallrohre), Sicherheitstritte oder Standsteine für den Kaminfeger und Schnee-fangsysteme mit dem Planer besprechen, um bei der Kostenkalkulation keine Überraschungen zu erleben.