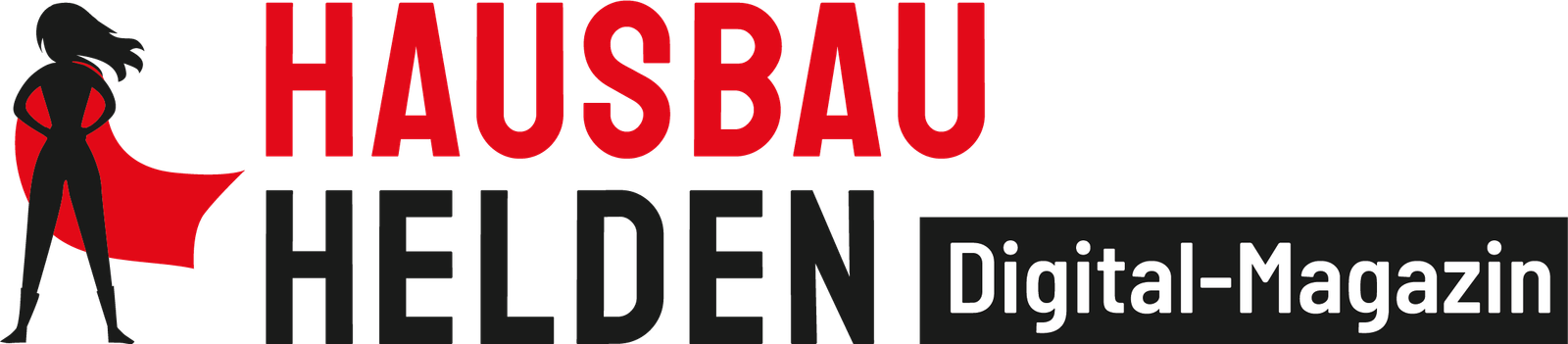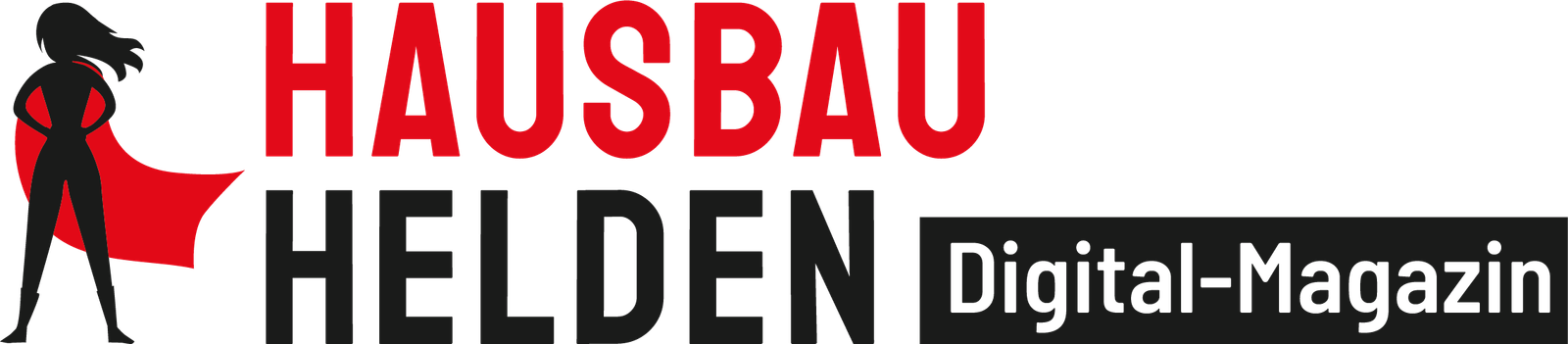Im Doppel besser?
Doppelhaushälften und Zweifamilienhäuser sind beliebte Wohnformen. Zum einen fördern sie gemeinschaftliches Leben, zum andern lässt sich mit ihnen richtig viel Geld sparen. Wir haben die verschiedenen Aspekte beleuchtet, das Wissenswerte ausgearbeitet und gebündelt.
Der kleine Unterschied
Eine Doppelhaushälfte wird als Gebäude mit zwei aneinandergebauten, eigenständigen Haushälften definiert, die beide über eine gemeinsame Hauswand, der Haustrennwand, miteinander verbunden sind. Die Haustrennwände werden aus Gründen des Schallschutzes aus zweischalig gemauerten Trennwänden ausgeführt. Die Grundrisse sind meist spiegelbildlich ausgeführt. Jede Haushälfte hat ihren eigenen, separaten Eingang und in der Regel auch einen eigenen Gartenanteil.

Foto: sedrik2007/www.elements.envato.com
Im Zweifamilienhaus liegen die einzelnen eigenständigen Wohneinheiten übereinander oder auch nebeneinander. Charakteristisch ist, dass es fast immer nur einen Hauseingang gibt und die darin wohnenden Parteien sich diesen und auch das Treppenhaus teilen. Genutzt werden Zweifamilienhäuser häufig als gemeinsames Wohnobjekt von Eltern und erwachsenen Kindern mit Familie oder gerne auch als Kapitalanlage. Beide Wohnformen haben den Vorteil, dass sie den bauenden Parteien spürbare Kostenvorteile bringen.
Trotz des gleichen optischen Looks und der gleichen Grundfläche der Doppelhäuser sowie der häufig identischen Wohnungsgrundfläche im Zweifamilienhaus bergen beide Bauarten ein hohes Maß an Individualität in der Gestaltung. Im Inneren des Doppelhauses können die Grundrisse auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Im Zweifamilienhaus können die jeweiligen Wohnflächen mit individuellen architektonischen Entwürfen umgesetzt werden.
Bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde erfährt man, welcher Bebauungsplan für jeweilige Grundstücke vorgesehen ist, das heißt, ob auch für Doppel- oder Zweifamilienhäuser eine Genehmigung erteilt ist.
Einsparung bei Grundstückskauf und Bau
Bauland gemeinsam zu erwerben, halbiert die Kosten. Bei den heutigen Grundstückspreisen bedeutet dies eine nicht zu unterschätzende finanzielle Ersparnis. Entscheiden sich zwei Baufamilien für den Bau eines Doppelhauses, werden sich auch die Kosten für das Haus selbst verringern. Allein schon die Haustrennwand ist günstiger als die sonst an dieser Stelle benötigte Außenwand. Die baurechtlich in den Landesbauordnungen vorgeschriebenen Abstände zum Nebenhaus, die zwischen 2,5 und 3 Metern liegen, entfallen auf dieser Seite des Hauses. Auf die Gesamtlänge eines Grundstücks gesehen, reduzieren sich dadurch die Kosten insgesamt. Es entstehen zudem weniger Materialkosten und der Arbeitsaufwand ist geringer.
Ein weiterer Punkt ist die Ersparnis der Architektenkosten. Die Kosten für die Erdarbeiten, Erschließungs- und Vermessungskosten verteilen sich auf zwei Parteien. In Summe verringert sich für jede Baufamilie die Gesamtsumme also deutlich. Um klare Besitzverhältnisse zu schaffen, sollte das Grundstück vor dem Kauf grundsätzlich in zwei separate Bauplätze aufgeteilt werden. Das beugt im Falle des Verkaufs einer Doppelhaushälfte potenziellen Schwierigkeiten vor.
Reduzierung von Energiekosten

Foto: wirestock/www.elements.envato.com
Die schon erwähnte gemeinsame Haustrennwand macht sich finanziell nicht nur bei den Baukosten bemerkbar. Auch später trägt sie durch die Verringerung des Wärmeverlustes einen nicht unerheblichen Anteil zur Energieersparnis bei, denn bei jeder Haushälfte geht Wärme nur noch über drei, anstelle der üblichen vier, Außenwände verloren.
Wer sich noch mehr Sparpotenzial sichern möchte, einigt sich am besten auf die Anschaffung einer gemeinsam nutzbaren Heizungsanlage. Durch diese Maßnahme sinken die Investitionskosten für jede Partei.
Der Umwelt zuliebe

Die Einsparung des Baugrunds hat nicht nur den schon oben erwähnten finanziellen Vorteil. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der geringere Bedarf an Grundfläche und folglich die Reduzierung versiegelter Flächen. Dies wiederum ist wichtig für die Umwelt, denn wenn Bodenflächen dauerhaft „zubetoniert“ werden, hat das die allseits bekannten Folgen für das Klima: Eine davon ist, dass das Regenwasser nicht mehr versickern kann und dadurch ein erhöhtes Risiko für Überschwemmungen entsteht. Darüber hinaus geht fruchtbarer Boden verloren, wodurch sich wiederum die Artenvielfalt reduziert. Des Weiteren sind Bauprojekte in Gemeinschaft aufgrund des daraus erfolgenden reduzierten Materialeinsatzes um einiges ressourcenschonender.
Es prüfe, wer sich lange bindet
Der Gedanke, ein gemeinsames Bau- und Wohnprojekt anzugehen, ist grundsätzlich eine tolle Sache. Egal ob im Doppel- oder auch im Zweifamilienhaus: Mit beiden Wohnformen lassen sich unterschiedliche Lebensgemeinschaften umsetzen. Erfahrungsgemäß entscheiden sich für ein Doppelhaus eher zwei separate Familien, die in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen. Der Vorteil dieser Wohnform ist die klare Regelung der Grundstücksrechte. Jede Partei hat ihr eigenes Grundstück, das mit der Grundstücksgrenze eindeutig definiert ist.

Plant man ein gemeinsames Bauvorhaben im Familienverbund, so ist in vielen Fällen ein Zwei- oder auch Dreifamilienhaus die gängige Lösung. Setzt man ein solches Bauvorhaben ohne Familienverbund um, besteht die Möglichkeit, die Finanzierung über die Vermietung von einer oder zwei Wohnungen zu unterstützen.
Passt die soziale Baugemeinschaft gut zusammen und sind grundlegende Anliegen jeder Wohnpartei von vornherein offen besprochen, abgeklärt und abgesichert, dann ist im Doppel zu bauen doppelt gut. Schon im Alltag werden Vorteile schnell sichtbar, und wenn’s nur mal kurz um das Ausleihen eines Gartengeräts, die Hilfe bei einem technischen Problem, beim Einkauf oder auch ums Aufpassen auf den Nachwuchs geht.
Abstand wahren
Ganz klar: Ein gut funktionierendes Miteinander geht nicht, ohne die Privatsphäre des anderen zu respektieren. Aber schon im Voraus lassen sich anhand architektonischer Überlegungen heikle Punkte vermeiden. So können im Außenbereich zum Beispiel Sichtschutzelemente für die nötige Abgrenzung sorgen. Im Eingangsbereich wird aus diesem Grund beispielsweise Platz für Müllboxen, Fahrradunterstände oder sogar Carports eingeplant. Terrassen müssen sich nicht zwangsläufig nebeneinander befinden, sondern können auch so geplant werden, dass sie außer Sichtweite voneinander liegen und so jede Partei für sich den Aufenthalt im Freien genießen kann. Im Inneren des Gebäudes lassen sich Maßnahmen mithilfe einer geschickten Grundrissplanung umsetzen. Dabei ist es am wichtigsten, Ruheräume wie zum Beispiel die Schlafzimmer, nicht direkt neben sogenannte „Aktionsräume“ wie das Wohn- und Esszimmer oder auch die Küche zu positionieren. Dann funktioniert das Leben „Wand an Wand“ in der Regel ohne Einschränkungen.
Achtung Lärmschutz

Einfamilienhäuser sind auch deshalb besonders beliebt, weil man weniger Rücksicht auf andere nehmen muss, zum Beispiel in Bezug auf die Lärmempfindlichkeit von Nachbarn. Im Doppelhaus sorgt bei diesem Problem die oben schon erwähnte, vorgeschriebene Haustrennwand für Abhilfe. Sie muss vorschriftsmäßig mit einer mindestens drei Zentimeter großen Fuge mit Dämmung aus Mineralwolle versehen sein. Diese Trennung zieht sich vom Fundament bis zum Dach und verhindert so effektiv die direkte Schallübertragung und potenzielle Lärmbelästigung von einem zum anderen Haus.
Beim gemeinsamen Leben innerhalb eines Hauses, also eines Zwei- oder Drei-familienhauses, gilt es, auf andere Weise konstruktive Maßnahmen für den Schallschutz zu treffen. Dies ist besonders im Holzbau vonnöten, denn im Massivbau wird der Schall besser geschluckt. Was also in den Räumen der einzelnen Stockwerke unabdingbar ist, ist ein guter Trittschall. Beim Verlegen der Böden, möglicherweise auch auf Treppen, sind Verlegeunterlagen mit Schallschutzeigenschaften ein probates Mittel, um unnötigen Ärger von vornherein auszuschließen.
Fazit: Symbiose mit Potenzial
Wenn du die oben genannten Punkte beachtest, kann gemeinschaftliches Bauen, sei es in Form einer Doppelhaushälfte oder eines Zwei- bzw. Mehrfamilienhauses, durchaus sinnvoll sein. Zum einen, was das Budget für den Hausbau betrifft, zum andern, wenn du in einer Gegend bauen möchtest, in der die Grundstückspreise sehr hoch sind. Das sind die auf der Hand liegenden finanziellen Vorteile. Die sozialen und unbestritten vorteilhaften Aspekte eines solchen Unterfangens sind ebenso nicht zu unterschätzen, stehen sie doch im besten Fall für ein schönes Leben im Sozial- oder Familienverbund und mit viel gemeinschaftlichem Miteinander.