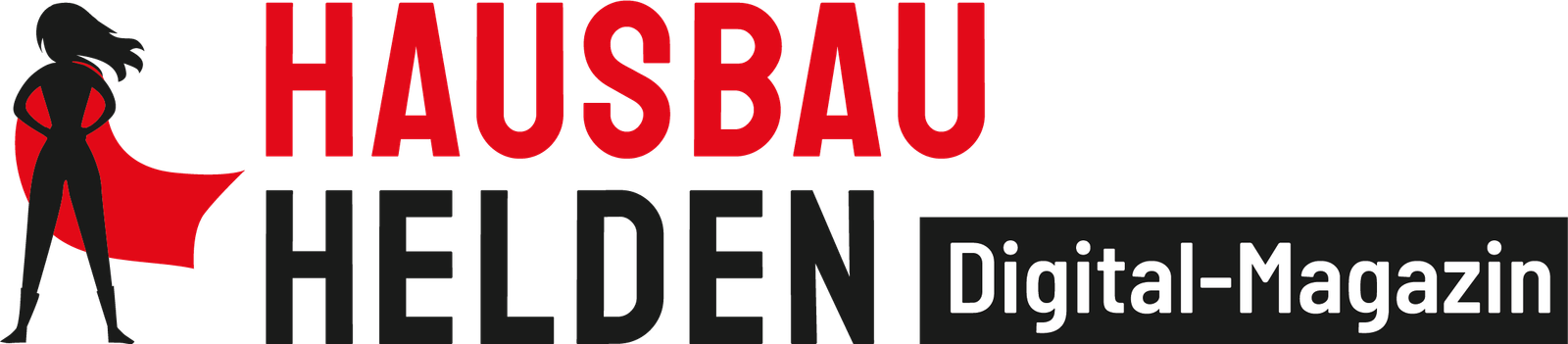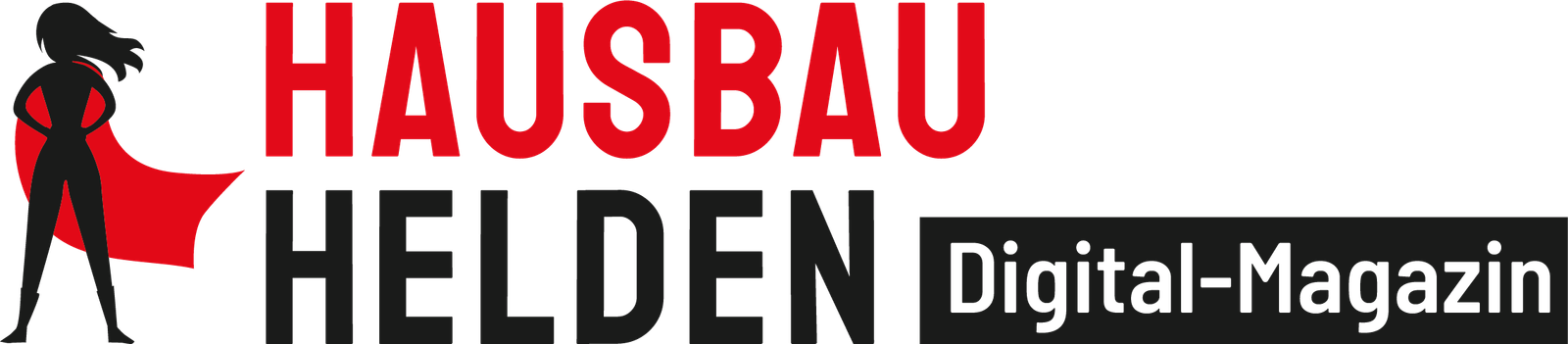Stadthäuser – mitten im Leben
Warum zieht es so viele von uns in die Stadt? Kurze Arbeitswege, fußläufig erreichbare Kitas und Einkaufsmöglichkeiten sind nur einige der Gründe. Obwohl die Motive unterschiedlich sind, haben doch die meisten ähnliche Hürden zu überwinden, um sich den Traum eines Stadthauses zu erfüllen. Wer aber bereit ist, sich auf die Herausforderungen des städtischen Bauens und dessen innovative Konzepte einzulassen, wird feststellen, dass diese Wohnform mehr ist als ein Kompromiss – es ist eine Antwort auf viele aktuelle Wohnfragen.
Vermehrt wird ein Haus in urbaner Lage als Wunschtraum abgestempelt, dessen Erfüllung nur mit viel Geld, guten Verbindungen oder vermachtem bebaubaren Land möglich ist. Der Grund: Bauland in urbaner Lage ist knapp und teuer. Wir zeigen dir, wie sich mit etwas Fantasie und Offenheit für neue Bauformen das eigene Stadthaus dennoch realisieren lässt.
Was genau ist ein Stadthaus?
Diese scheinbar einfache Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten – der Begriff wird nämlich uneinheitlich definiert. Grundlegend handelt es sich um ein meist mehrstöckiges Wohngebäude im urbanen Raum, das vielfältige Formen annehmen kann. Dabei könnte es sich zum Beispiel um ein Einzel-, Reihen- oder Doppelhaus in städtischer Lage handeln, das sich durch eine schmale Grundfläche, mehrere Etagen und eine durchdachte Raumnutzung auszeichnet. Wer sich ein Stadthaus wünscht, dem stehen neben diesen Varianten aber auch alternative Formen der Nachverdichtung zur Auswahl, die wir euch in diesem Beitrag vorstellen.
Vorteile des Lebens in der Stadt
Ein Stadthaus verbindet die Vorteile eines Eigenheims mit der Effizienz des städtischen Lebens: kurze Wege, gute Infrastruktur, eine lebendige Nachbarschaft. Ideal ist das Stadthaus sowohl für Paare, Familien als auch für Alleinstehende, die nicht auf Individualität verzichten möchten – aber trotzdem mitten im Geschehen leben wollen.

Lösungen für die Zukunft: Nachverdichtung
Das Bauen in der Stadt bezahlbarer zu machen und dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte im Blick zu behalten, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Um in gewachsenen Quartieren zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, kommen zum Beispiel Konzepte der sogenannten Nachverdichtung infrage. Dabei handelt es sich um die bauliche Nutzung bisher unbebauter oder mindergenutzter Flächen innerhalb einer bereits bestehenden Bebauung und die Erhöhung der Kubatur innerhalb bereits bestehender Bebauung.
| Art der Nachverdichtung | Beschreibung |
| Bauen in zweiter Reihe | Das Errichten eines Gebäudes hinter einem Bestandsbau. |
| Aufstockung | Ein bereits bestehendes Gebäude wird um ein oder mehrere Stockwerke erhöht. |
| Umnutzung | Der ursprüngliche Nutzen eines Gebäudes oder eines Grundstücks wird geändert. Hierzu zählt zum Beispiel die Umwandlung eines Bürogebäudes in Wohnraum. |
| Schließen von Baulücken | Unbebaute oder unter ihren Möglichkeiten genutzte Grundstücke innerhalb einer ansonsten geschlossenen Siedlungsstruktur werden bebaut. |
| Anbau | Ein bereits bestehendes Hauptgebäude wird durch den Anbau eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils erweitert. |
Herausforderung Grundstückssuche: Mut zur Lücke
Der erste Schritt zum Stadthaus ist – wie bei jedem Bauprojekt – die Suche nach dem Grundstück. Da Bauland in Städten knapp und teuer ist, zahlen sich Geduld und eine kreative Herangehensweise aus. So lassen sich auch innerstädtische Baulücken, Restgrundstücke oder kleine Areale nutzen, um neuen Wohnraum zu schaffen.
Wer bereit dazu ist, ein kleineres oder untypisch geformtes Grundstück zu erwerben, könnte sein Haus trotz Preisentwicklung in einer guten urbanen Lage errichten. Kleine Grundstücke sind für Investoren nämlich oft uninteressanter, wodurch ein großer Teil der Konkurrenz wegfällt. Allerdings solltest du den Planungsaufwand bei einem ungewöhnlichen und kleinen Grundstück nicht unterschätzen. Hier musst du dich mit den individuellen Gegebenheiten vor Ort gründlich auseinandersetzen.

Clevere Raumkonzepte
Die Architektur eines Stadthauses ist geprägt von vertikalem Denken, weshalb in die Höhe, statt in die Breite geplant werden muss. Auf kleiner Grundfläche entstehen meist drei bis vier Etagen, in denen Wohnen, Arbeiten und Leben geschickt organisiert werden sollten. Ausschlaggebend ist dabei eine clevere Grundrissplanung, um die vorhandene Fläche möglichst sinnvoll auszunutzen. Die Treppe wird beispielsweise zur zentralen Achse, offene Grundrisse schaffen ein großzügiges Raumgefühl – trotz kompakter Maße. Außerdem sollten Verkehrsflächen wie Flure und Dielen möglichst klein ausfallen, damit die übrigen Wohnbereiche an Platz gewinnen.
| Tipp: Auf einer kleinen Grundfläche solltest du reichlich Stauraum einplanen. Eine clevere Methode ist es den Raum unter der Treppe nutzbar zu machen, indem dort ein Schrank oder eine Garderobe eingerichtet wird. |
Herausforderung Grundstückssuche: auf alt mach neu
Eine weitere Möglichkeit wäre das Bauland auf dem Dach eines bereits bestehenden Gebäudes zu suchen. Das Schlagwort lautet: Aufstockung. Ein großer Vorteil der Aufstockung ist die Einsparung zusätzlicher Grundstückskosten, da das Gebäude schon vorhanden ist. Außerdem sind die Bauzeiten kürzer, wodurch die Beeinträchtigung der Nachbarn durch beispielsweise Lärm und Schmutz reduziert wird.
Es gibt mehrere Möglichkeiten auf ein Bestandsgebäude aufzustocken: Bei einer Geschoss- oder Dachaufstockung wird beispielsweise der Dachstuhl eines Bestandsbaus abgetragen und ein neues Geschoss errichtet. Das aufgesetzte Geschoss kann in Holzständerbauweise durch Aufmauern oder als vorgefertigtes Modul ausgeführt werden. Nach Vollendung der Arbeiten wird das Dach neu gebaut oder rekonstruiert. Ein bestehendes Gebäude kann außerdem durch die Erhöhung des Kniestocks erweitert werden. Der Kniestock ist eine Fortsetzung der Gebäudeaußenwand oberhalb des Dachbodens, auf die der Dachstuhl aufgelegt wird. Die Höhe des Kniestocks beeinflusst das Raumvolumen und die nutzbare Fläche.

Auch in puncto Nachhaltigkeit hat eine Aufstockung Vorteile, da dabei generell Ressourcen gespart werden und kein weiterer Boden versiegelt wird. Unter einer Bodenversiegelung versteht man Fläche, die bebaut, betoniert oder anderweitig befestigt wird, wodurch kein Regenwasser versickern kann. Das hat wiederum Auswirkungen auf den Wasserhaushalt.
| Tipp: Solltest du an einer Aufstockung interessiert sein, so benötigst du eine Baugenehmigung und Profiunterstützung bei der Planung. Zu den Experten, die du unbedingt zurate ziehen solltest, gehören ein bauvorlageberechtigter Architekt und ein Statiker. Letzterer muss sicherstellen, dass das Bestandsgebäude die zusätzliche Last des neuen Geschosses auch wirklich tragen kann. |
Bauprozess und rechtliche Rahmenbedingungen
Gerade in innerstädtischen Lagen sind Themen wie Brandschutz, Schallschutz und Grenzbebauung komplexer als in Neubaugebieten auf der grünen Wiese. Hast du ein geeignetes Grundstück ins Auge gefasst, so sollte in einem ersten Schritt festgestellt werden, ob dieses überhaupt die Bebauung zulässt, die du dir vorgestellt hast. Gehe vor dem Erwerb des Grundstücks daher zu dem Baurechtsamt der zuständigen Stadt. Dort wird dir der sogenannte Bebauungsplan alle notwendigen Informationen über die Bebaubarkeit des Grundstücks liefern. Dazu gehören zum Beispiel Vorgaben zu der Anzahl der Geschosse, festgelegte Abstandsflächen zu den Nachbarhäusern und ob eine Dachform vorgegeben ist. Sowohl der Bauantrag als auch die Genehmigungsverfahren, die Abstimmungen mit den Behörden und – nicht zu unterschätzen – die Kommunikation mit den Nachbarn sollten am besten professionell begleitet werden.
Wer in einem historischen Stadtteil neu bauen möchte, der muss außerdem beachten, dass sich die Architektur des Hauses in den Kontext der umliegenden Gebäude fügt. Hierdurch wird gesichert, dass der städtebauliche Gesamteindruck stimmig bleibt. Planst du ein Haus in einem historischen Viertel zu errichten, wirst du bei deinem Bauvorhaben von Denkmalbehörden beraten und begleitet, um historische Zusammenhänge im Blick zu behalten.
Fazit
In Zeiten knapper Grundstücke und wachsender Städte bietet das urbane Bauen eine attraktive Alternative zum klassischen Einfamilienhaus im Grünen. Mit etwas Kreativität, Geduld und Offenheit für neue Bauformen lassen sich dabei Nachhaltigkeit und die Vorzüge des Lebens in der Stadt auf einzigartige Weise miteinander vereinen.
Du hast noch mehr Fragen rund ums Thema Stadthäuser? Antworten gibt es in unserer