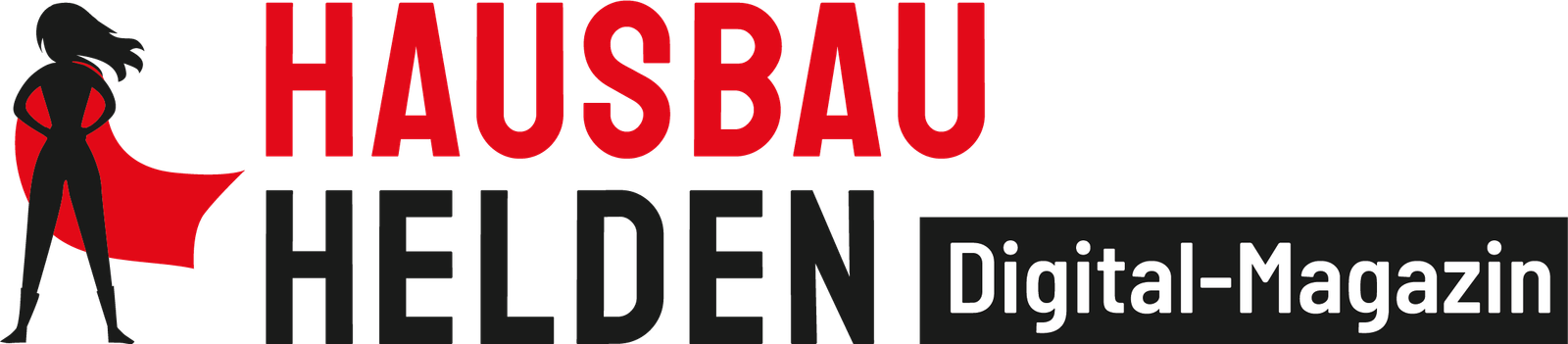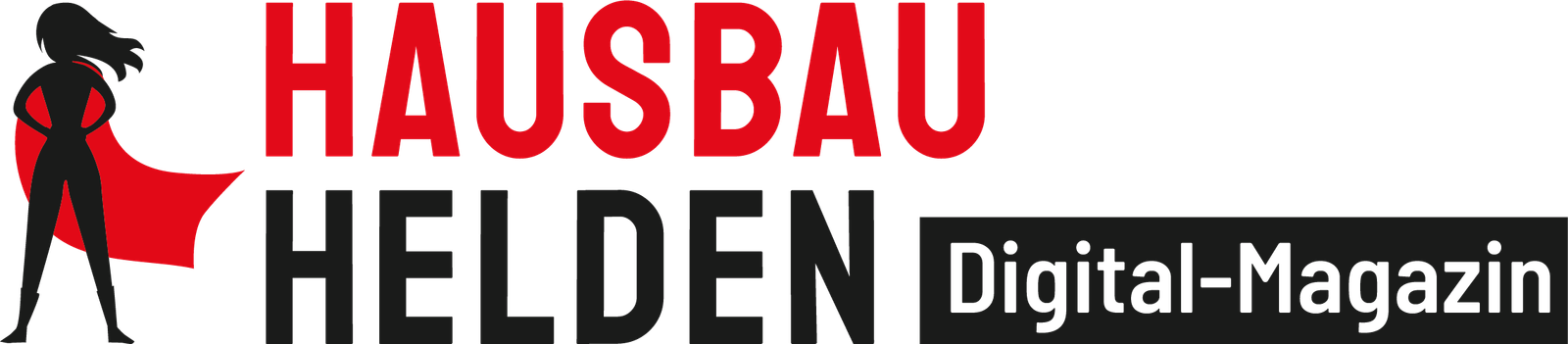Zusammen bauen
Gegenwärtig ist der Hausbau eine kostspielige Angelegenheit. Um den Traum einer eigenen Immobilie dennoch umsetzen zu können, gibt es die Möglichkeit, in einer Baugemeinschaft (ab zwei Parteien) zu bauen. Das Interesse ist groß, die Vorteile überzeugen. Der wichtigste Faktor ist der Kostenfaktor, dicht gefolgt von der sozialen Komponente.
Die Definition des Bundesverband Baugemeinschaften e.V. für ein gemeinschaftliches Bauprojekt lautet folgendermaßen:
Die Baugemeinschaft ist ein Zusammenschluss von privaten Haushalten, die durch gemeinsames Planen und Bauen individuellen Wohn- und gemeinsamen Lebensraum schaffen, um ihn langfristig selbst zu nutzen.
Warum gemeinsam bauen
- Ein gemeinsames Bauprojekt ist eine Möglichkeit für die Realisierung einer eigenen Immobilie, z.B. in Form eines Reihen-, Doppel- oder Mehrfamilienhauses. Hohe Erwerbskosten verteilen sich auf alle Bauherren.
- Umsetzbar sind fast alle Arten des Wohnens vom Doppelhaus übers Reihenhaus und Zwei- oder Dreifamilienhaus bis hin zum Mehrfamilienhaus.
- Je nach Region liegt die Kostenersparnis bei etwa 25 Prozent.
- Es ist weniger Grundfläche nötig, dadurch sinken die anteiligen Grundstückskosten und die Belastung des Ökosystems vermindert sich.
- Die Kosten für Erschließung, Architekt und Bauunternehmen verteilen sich auf die beteiligten Parteien.
- Die Grunderwerbsteuer und die Notarkosten werden nur auf die Grundstückskosten angerechnet.
- Die Option zur gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten birgt weiteres Sparpotenzial.
- Gemeinsam bauen fördert das soziale Miteinander. Besonders im Familienverbund sind Win-Win-Situationen (Kinderbetreuung, Pflege) leichter umsetzbar.
- In gemeinschaftliche Bauprojekte können nachhaltige Konzepte einfließen, wie zum Beispiel im Bereich von Energieversorgung, Carsharing oder Ähnlichem.

Geeignete Haustypen
| DH | RH | MFH | MGH |
|---|---|---|---|
| günstiger als zwei Einzelhäuser | weniger Außen-wände, deshalb wirtschaftlich im Bau | geteilte Baukosten | geteilte Baukosten |
| 2 Familien, 1 Bau | ideal für mehrere Parteien | Gemeinschaftsfläche denkbar (Garten, Dachterrasse, Hobbyräume) | Unterstützung im Alltag, z.B. Kinderbetreuung, Pflege |
| teilweise gemeinsame Infrastruktur möglich | flexibel erweiterbar | klare Abgrenzung der Privaträume | generationenüber-greifende Planung |
| Eignung: hoch | Eignung: hoch | Eignung: sehr hoch | Eignung: hoch |
Die vier Stufen der Baugemeinschaft
Das Bauen in der Gemeinschaft läuft im Allgemeinen in vier Phasen ab:
1 – Zunächst wird die Gruppe der Bauenden als Interessengemeinschaft definiert. In dieser Phase legt man die grundlegende Zielsetzung mit all den dazugehörigen Themen fest.
2 – Der nächste Schritt ist die Planungsgemeinschaft. In diesem Stadium erfolgt die Grundstücksuche, die Suche nach einem Architekten, dem Bauunternehmen usw.
3 – Nach dem Erwerb eines Grundstückes bilden die Bauenden schließlich eine Baugemeinschaft, die bis zur Fertigstellung des Objekts bestehen bleibt. Die Verantwortung liegt nun in jeglicher Hinsicht bei allen Beteiligten. Ab dieser Phase bindet man sich verbindlich an die Gruppe.
4 – Ist das Haus fertig und bezugsbereit, werden die Bauherren zu Eigentümern, sie bilden von nun an eine Eigentümergemeinschaft. Bei Doppel- oder Reihenhaus jeweils mit einem eigenen Grundstücksanteil. Im Mehrfamilienhaus ist jedes Mitglied Teileigentümer.




1: Interessengemeinschaft
2: Planungsgemeinschaft
3: Baugemeinschaft
4: Eigentümergemeinschaft
Fotos: www.elements.envato.com/Abb. 1 Azin90/Abb.2 ??????/Abb.3 thananit_s/Abb.4 YuriArcursPeopleimages
Unterschiedliche Baugemeinschaften
| Freie private Baugemeinschaft | Betreute private Baugruppe |
| – ist eine Gruppe eigeninitiativer Bauherren (oft Freunde, Familie, Bekannte), die Organisatorisches, wie zum Beispiel die Suche nach Architekt und Baufirmen selbst übernimmt – Umsetzung eher kleinerer Projekte wie Doppel-, Reihen- oder Zwei-/Mehr-familienhaus – in der Regel rechtlich eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), das heißt, das Grundstück wird gemeinsam gekauft und in Wohneinheiten aufgeteilt. Nach Fertigstellung geht es über in eine Eigentümergemeinschaft mit klar geregelten Rechten und Pflichten. Vorteil: GbR ist im Grundbuch eingetragen. Bei Änderungen muss der Eintrag nicht gebührenpflichtig geändert werden. | – sie wird von einem sogenannten „Projektinitiator“ (meist der Architekt) begleitet. Er gründet die aus unterschiedlichen Interessenten bestehende Gruppe. Im weiteren Verlauf unterstützt ein Projektleiter das Bauvorhaben bei allen anfallenden organisatorischen Belangen. – meist handelt es sich hierbei um größere Bauprojekte im außerfamiliären Bereich mit mehreren Bauherren. |
Ein Muss: die offene Kommunikation
Ein gemeinsames Bauprojekt bietet Vorteile. Dennoch muss man bei einer solchen Bindung, die man mit Familie, Freunden oder anderen Personen eingeht, alle Bedingungen genau klären. Nur durch einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander kann ein Projekt dauerhaft erfolgreich sein. Denn immer wieder scheitern solche Vorhaben an den unterschiedlichen Vorstellungen der Beteiligten.

YuriArcursPeopleimages
Neben all den grundlegenden, den Objektbau betreffenden Themen, sollte im Vorfeld auch über alles Alltägliche gesprochen werden. Dazu zählt unter anderem auch die Gewährleistung der Privatsphäre. Nicht jeder möchte zum Beispiel seinen Außenbereich zum offenen Terrain für alle machen. Darüber hinaus müssen gemeinsame Bereiche wie der Eingangsbereich, ein Treppenhaus und die Unterbringung der Mülltonnen zur Zufriedenheit aller Parteien ausgeführt werden. Weitere Punkte sind Ordnung und Sauberkeit sowie die Haustierhaltung oder das Feiern von Festen. Unterschiedliche Ansichten können in allen Bereichen zu schwer
lösbaren Konflikten führen. Deshalb ist ein gewisses Maß an Kompro-
missbereitschaft unterlässlich.

Ha4ipuri
Die finanzielle Seite muss bei gemeinschaftlichem Bauen klar und offen kommuniziert werden. Bei großen Unterschieden der zur Verfügung stehenden Mitteln aller Beteiligten, ist es unumgänglich, eindeutige Festlegungen und Vorkehrungen zu treffen. Dazu gehört auch die Überlegung, was passiert, wenn eine Partei zahlungsunfähig werden sollte. Oder sich die Lebensumstände ändern – etwa aufgrund einer Scheidung, sowie alle Vorkommnisse, die das Bauprojekt beeinflussen könnten. Dazu zählen nicht nur Zahlungsschwierigkeiten, sondern auch Auszug, Verkauf oder Vermietung einer Partei.

Auch folgende Fragen sollte man sich stellen: Wie viel Eigenleistung kann erbracht werden, um die Kosten zu minimieren? Sind sich alle Bauenden in diesem Punkt einig oder gehen die Meinungen so weit auseinander, dass es schwierig wird, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Des Weiteren ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Aufteilung der Räume aussehen soll. Beim Doppel- und Reihenhaus ist zu beachten, dass Schlafräume im besten Fall nicht Wand an Wand mit dem nachbarlichen Wohnzimmer liegen. Hier kommt das Thema Schallschutz ins Spiel. Und selbst die Gartenplanung sollte Gegenstand der Vorabgespräche sein.
Fazit
Wer gerne in einem engen sozialen Umfeld und gemeinschaftlichem Miteinander lebt, für den hält das gemeinsame Bauen viele Vorteile bereit. Voraussetzung für gutes Gelingen ist allerdings eine hohe Kompromissbereitschaft und eine klare, offene Kommunikation aller Beteiligten über alle relevanten Themen. Für die Umsetzung bedarf es einer rechtlich und finanziell einwandfreien Absicherung durch Fachleute wie Notare, Architekten und Baujuristen.
Entdecke weitere Inspirationen und folge uns auf Pinterest: